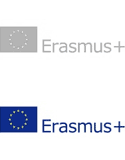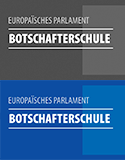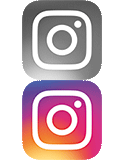Deutsch-französisches Seminar
Erfahrungsberichte und zukünftige Planungsgrundlage
Kontakt
Wenn Sie sich für dieses Projekt interessieren, wenden Sie sich bitte an Maren Johannsen joh@rrbk.de oder Karl-Friedrich Hutter hut@rrbk.de
Träger
Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-französischen Seminar des Gustav-Stresemann Instituts und dem französischen Verein Cefir, Dunkerque, mit finanzieller und pädagogischer Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks



Zielgruppe und Voraussetzungen für die Teilnahme
Zielgruppe ist in jedem Jahr die Oberstufe der Europaklasse der Zweijährigen Höheren Handelsschule (HE) des Rudolf-Rempel-Berufskollegs und auf französischer Seite Schüler einer Groß- und Außenhandelsklasse von unserem Partnerberufskolleg Lycee general et technologique Robert Schuman, Metz.
Voraussetzungen sind Grundkenntnisse in der jeweils anderen Sprache.
Inhalt
Im Rahmen des deutsch-französischen Austauschseminars wird jeweils im Jahreswechsel eine deutsche oder eine französische Großstadt besucht. In dieser treffen sich die Schüler*innen aus Metz und Bielefeld, um politische und gesellschaftliche Aspekte der Stadt zu erkunden und aufzuarbeiten. Dabei werden Kenntnisse über das jeweilige gesellschaftliche System der beiden Länder vertieft. Zumeist geschieht dies anhand von Stadtrallyes, Besichtigungen und interaktiven Erkundungen. Auch berufliche Perspektiven in Frankreich und Deutschland werden erschlossen. Schüler*innen knüpfen hier erste Kontakte zu Unternehmen, die im Laufe der Woche besichtigt werden. Dies sind zumeist Industrie- oder Groß- und Außenhandelsunternehmen.
Auch sollen dabei Aspekte des Arbeitslebens und Zukunftsperspektiven in den Partnerländern entdeckt werden. Hierzu erstellen die Schüler*innen vorher im Unterricht Präsentationen, um dem jeweiligen anderen Land die Inhalte nahe zu bringen.
Ein weiterer, wichtiger Punkt sind die interkulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schüler*innen, die anhand von Stereotypenschocks im Plenum kreativ erarbeitet werden.
Die ganze Woche über vertiefen und erweitern die Schüler*innen zudem ihre Sprachkenntnisse, da zwei Seminarleiter*innen (französisch muttersprachlich und deutsch) Sprachanimationen durchführen und die Schüler*innen spielerisch dazu bewegen, in der jeweiligen Zielsprache zu kommunizieren.
Deutsch-französisches Seminar 2019
Bericht von der Internationalen Begegnung
Unser französisch-deutsches Seminar fand in diesem Jahr vom 25. – 30. November 2019 in Straßburg statt. Auch in diesem Jahr begann das Programm wieder mit Aktivitäten zum gegenseitigen Kennenlernen. In einem interkulturellen Abend stellten wir unseren Partnern die Besonderheiten unserer Regionen vor. Außerdem arbeiten wir gemeinsam zu den Themen „Vorurteile“ und „Unterschiede bei den Schul- und Ausbildungssystemen beider Länder“ und führten Sprachanimationen durch, um die jeweilige Partnersprache besser kennen zu lernen.
Als zentraler Programmpunkt konnten wir das Europaparlament besuchen und anschließend in unserem Seminarraum eine zweisprachige Parlaments-Simulation durchführen.
Bei unserer Führung durch das Parlament wurden wir auf eine französischsprachige und eine deutschsprachige Führung aufgeteilt. Beide Gruppen konnten dann aber annähernd gleichzeitig im Parlamentssaal die Reden verfolgen. Wir waren überrascht, dass nicht diskutiert, sondern nur Rede an Rede gereiht wurde. Alle Reden wurden simultan in alle Mitgliedssprachen gedolmetscht.
Am folgenden Tag haben wir dann eine Parlamentssitzung simuliert. Wir wurden den Fraktionen zugelost und berieten über „Gesetzentwürfe“, die wir zuvor zu verschiedenen Politikfeldern in Gruppenarbeit entworfen hatten. Bei uns wurde konsekutiv aus dem Französischen ins Deutsche und umgekehrt gedolmetscht. Die Rahmenbedingungen waren in unserer Simulation günstiger für eine lebhafte Diskussion, weil man sich direkt melden und vom „Parlamentspräsidenten“ drangenommen werden konnte.
Schnell bildeten sich in unserem „Parlament“ zwei politische Lager: die „linken“ und die „rechten“ Parteien unterstützten sich jeweils gegenseitig, um bei der Diskussion die eigene Position zu stärken. Sprache und Nationalität spielten bei der Position zu den „Gesetzentwürfen“, über die wir berieten, keine Rolle. Die Diskussion innerhalb der Fraktionen war wegen der Sprachbarriere ein wenig schwierig, wurde aber im Laufe der Zeit besser.